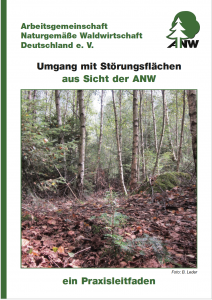Buchbesprechung
Bei dem Stichwort „Wald“ denkt man kaum an England, vielleicht
nur an den Sherwood Forest mit Robin Hood. Dies ist auch kaum verwunderlich, da
die Landesfläche von Großbritannien nur mit knapp 13 % Wald bestockt ist.
Ein kurzer Hinweis in einer Zeitschrift auf dieses Buch des
englischen Autors John Lewis-Stempel hat mich neugierig gemacht, ich habe mir
das Buch gekauft und es keinen Moment bereut.
John Lewis-Stempel ist Landwirt
und Schriftsteller (oder umgekehrt) und
bewirtschaftet einen 16 ha- Hof im ländlichen Herefordshire im Westen
Englands, kurz vor der Grenze zu Wales. Er pachtet den Cockshutt Wood mit 1,5
ha, um ihn zu bewirtschaften.
Hier fängt nun der gravierende Unterschied zur aktuellen
deutschen Forstwirtschaft an. Der Autor definiert Waldwirtschaft nicht als
Holzwirtschaft, sondern als Teil der Landwirtschaft, wie es bei uns vor vielen
Jahren auch war. Heutigen Forstleuten werden vermutlich die Haare zu Berg
stehen, wenn sie lesen, wie er Schweine, Rinder, Schafe ganz bewußt in den Wald
treibt, um das wuchernde Brombeergestrüpp klein zu halten und so Teile der
Waldvegetation als Futter zu nutzen. Holz
ist für den Eigenbedarf da, aber auch Pilze, Beeren, Kaninchen, Grauhörnchen,
Waldschnepfen etc. für das Essen. So finden sich im Buch Rezepte für
Kastanienpüree, Wildapfelgelee, Eichelkaffee, Holunderblütensekt,
Bärlauch-Dolmades,u.a.
John Lewis-Stempel ist ein hervorragender Beobachter, hat ein sehr großes Wissen um
Pflanzen und Tiere und beschreibt den Wald mit seinen Bewohnern bis in feinste
Einzelheiten. Das Buch ist das Tagebuch seines letzten Jahres im Cockshutt Wood
und man kann mit ihm die spannenden Entwicklungen im Jahresverlauf erleben.
Hier kommt nun eine weitere Besonderheit des Buches. Der Autor
ist ein Poet und man muss oft seine Worte, Sätze, Gedankenverbindungen zweimal
lesen, um sie richtig zu würdigen. Sätze
wie „Eintagsfliegen fallen auf den Teich und sterben wie tragische Ballerinas“
oder „Bei meinem Spaziergang störe ich das Teichhuhn auf, das fußbaumelnd flach
davonfliegt und Narben auf der Wasserfläche hinterläßt.“ Solche poetischen
Umschreibungen finden sich auf fast jeder Seite und erhöhen das Lesevergnügen.
Auch kennt sich der Autor sehr gut in der englischen Geschichte und der ,auch
antiken, Literatur aus und so gibt es viele Zitate und Hinweise für eigenes
Lesen.
Man muss sich auf das Buch vorurteillos einlassen und nicht bei
jedem Handeln oder bei jedem ungewöhnlichen Satz denken, da stimmt was nicht.
John Lewis-Stempel schreibt mit dem feinen, typisch englischen Humor und viel
Selbstironie, die, wenn man dies mag, das Buch für mich so interessant, schön
und lesenswert machen. Ich habe es in einem Sitz, allerdings mit vielen Pausen
zum Nachdenken, gelesen und werde es immer wieder zur Hand nehmen.
Jürgen Rosemund
John Lewis-Stempel
Im Wald – Mein Jahr im Cockshutt Wood
Verlag Dumont, Köln 2020, 282 Seiten, € 22.–